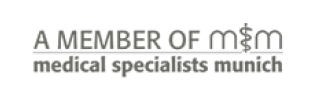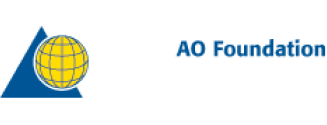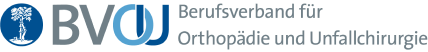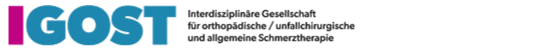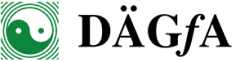Schulterinstabilität: Ausgerenkte Schulter behandeln
Schulterinstabilität
Unter einer Instabilität versteht man in der Orthopädie die Unfähigkeit, ein Gelenk stabil in seinem Gelenkverband zu halten. Eine Schulterinstabilität ist insbesondere dann behandlungsbedürftig, wenn es zu wiederholten Ausrenkungen (Luxationen) der Schulter kommt, welche darüber hinaus mit einer schmerzhaften Bewegungseinschränkung einhergehen. Ist es erstmals durch akute Überlastung zu einer Verrenkung der Schulter gekommen, liegt ein großer Schwerpunkt der weiteren Behandlung darin, erneute Luxationen zu vermeiden . Insbesondere der junge Patient ist einem erhöhten Risiko ausgesetzt.
Behandlung der Schulterinstabilität in München
Oftmals genügt nach erstmaliger Ausrenkung ein Aufbauprogramm unter physiotherapeutischer Anleitung zur Stärkung der Schultermuskulatur. Eine arthroskopische Operation ist dann angeraten, wenn die Schulter immer wieder auskugelt, was Folgeschäden an Sehnen, Bändern und Gelenk nach sich ziehen kann. Die Nachsorge im Falle einer minimalinvasiven Operation ist für den Behandlungserfolg von besonderer Bedeutung, da es gilt, eine sekundäre Bewegungseinschränkung (Schulterteilsteife) zu verhindern.
Ihre Vorteile im OrthoCenter München
- Orthopädischer Behandlungsschwerpunkt Wirbelsäulentherapie
- Große Bandbreite an konservativen und operativen Verfahren
- Sanfte Verfahren im Fokus: Dr. Riedel hat sich auf sanfte Schmerztherapie spezialisiert. Er war über 20 Jahre als Chefarzt in verschiedenen Kliniken für Rehabilitation, konservative Orthopädie und Schmerztherapie tätig
- Gelenke- & OP-Experte: Professor Dr. Lill ist spezialisiert auf die Behandlung von Gelenken. Zudem verfügt er über jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet der minimalinvasiven & arthroskopischen OPs.
- Zusammenarbeit mit weltweiten Kliniken und Forschungsinstituten
- Renommierte Privatpraxis: Das OrthoCenter ist international bekannt und begrüßt immer wieder Patienten aus dem Ausland, die zur Behandlung nach München kommen
Online Termin bei unseren
Orthopäden in München vereinbaren
Schnelle und einfache Online-Terminvergabe für Privatpatienten und Selbstzahler. Als serviceorientierte Praxis für Orthopädie bieten wir unseren Patienten die bequeme Online-Terminvereinbarung via doctolib oder mittels Kontaktformular an. Auf diese Weise können Sie rund um die Uhr einen Termin in unserer Praxis vereinbaren und sich in den meisten Fällen Ihren Wunschtermin sichern. So erhalten auch Patienten aus dem Ausland die Möglichkeit einer einfachen Terminvereinbarung bei unseren Orthopäden. Sollte die Terminvereinbarung einmal nicht gelingen oder alle für Sie möglichen Termine sind bereits vergeben, rufen Sie uns jederzeit gerne an.

Buchen Sie Ihren
Termin bei

Buchen Sie Ihren
Termin bei
Online Termin
bei unseren Orthopäden in München vereinbaren
Schnelle und einfache Online-Terminvergabe für Privatpatienten und Selbstzahler. Als serviceorientierte Praxis für Orthopädie bieten wir unseren Patienten die bequeme Online-Terminvereinbarung via doctolib oder mittels Kontaktformular an.
Ursachen
Das Schultergelenk ist aufgrund ihres komplexen anatomischen Aufbaus besonders anfällig für Überlastungen und Verletzungen. Kommt es aufgrund einer plötzlichen hohen Krafteinwirkung zu einer Überlastung, springt der Oberarmkopf aus der Schultergelenkspfanne. Zumeist geht diese Verrenkung mit begleitenden Verletzungen von Sehnen, Bändern und/oder der Knorpel-/Knochenstruktur einher. Wiederholte Luxationen mit Ausbildung einer instabilen Schulter können die Folge sein. Daher ist das Ausmaß einer vorliegenden Schulterinstabilität von einem Facharzt zu beurteilen und entsprechende weitere Behandlungsmaßnahmen einzuleiten.
Symptome
Bei einer instabilen Schulter kommt es zu wiederholten schmerzhaften Verrenkungen des Oberarmkopfes aus der Gelenkpfanne, z. B. bei Stürzen, sportlichen Überkopfaktivitäten oder auch nach einfachen Drehbewegungen. Dabei kann die Schulter oftmals nur mit fremder Hilfe wieder eingerenkt werden. Vereinzelt stehen auch unvollständige schmerzhafte “Subluxationen” im Vordergrund. Der betroffene Patient vermeidet bewusst gewisse Bewegungen der Schulter, die eine erneute Verrenkung verursachen können. Auch können sich in der Folge schmerzhafte Bewegungseinschränkungen ausbilden. Begleitverletzungen im Rahmen einer Schulterluxation können mittels Röntgen und Kernspintomographie diagnostiziert werden.

Ihr Schulter-Spezialist Prof. Dr. Lill
IHR ANSPRECHPARTNER BEI SCHULTERSCHMERZEN
Professor Dr. med. Lill ist ein renommierter Orthopäde mit reichlich Erfahrung in der Behandlung von Luxationen der Schulter. Am besten, Sie vereinbaren noch heute einen Termin im OrthoCenter München.